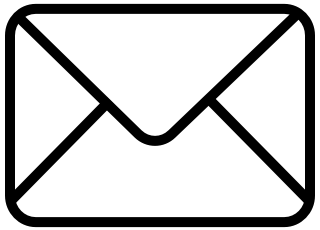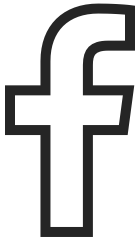Nie wieder Plastik?

Frau Dr. Weber, Sie prüfen das Verhalten biologisch abbaubarer Polymere in Meeren und heimischen Gewässern. Gibt es Entwicklungen im Bereich Bioplastik, die tatsächlich nachhaltig sind und Zukunft haben?
Miriam Weber: Die gibt es definitiv. Aktuell arbeiten wir eng mit Standardisierungsorganisationen zusammen. Unser Ziel ist es, offizielle Evaluierungsmethoden für die biologische Abbaubarkeit unterschiedlichster Stoffe in der Umwelt zu entwickeln und zu etablieren. Die Abbaubarkeit eines Materials hängt ja auch immer davon ab, wo es landet: in der industriellen Kompostieranlage, auf dem heimischen Kompost oder, auch dies leider immer noch, im Meer, in unseren Flüssen, Seen und Böden. Die Frage ist ja: Wollen wir unabhängig von fossilen Stoffen werden oder fokussieren wir uns mehr auf das Lebensende, also die Entsorgung? Idealerweise muss es um beides gehen.
Wenn Sie den neuen Standard etabliert haben, können wir dann endlich bedenkenlos im Plastik schwelgen?
MW: So unbequem es zunächst klingen mag, unsere oberste Prämisse ist: Reduzieren, Reduzieren, Reduzieren. Das gilt sowohl für den Verbrauch als auch für den Eintrag der Produkte in die Umwelt. Für den Delphin im Meer macht es keinen Unterschied, ob das Fischernetz, in dem er sich verfängt, aus erdölbasiertem oder marin biologisch abbaubarem Plastik besteht. Denn so schnell lösen sich selbst biologisch abbaubare Kunststoffe nicht auf. Will heißen: Die massive Akkumulation von großen Plastikstücken, dem sogenannten Makroplastik, in der Umwelt bekommen wir auch mit biologischer Abbaubarkeit nicht in den Griff. Das Gute ist, dass der Eintrag von Makroplastik in unsere Umwelt in den meisten Fällen vermeidbar ist, daran muss weltweit massiv und mit größtmöglicher Geschwindigkeit gearbeitet werden.
Trotzdem werden wir ja auch künftig nicht ganz auf plastikartige Stoffe verzichten können. Welche Materialien und Anwendungen wären denn Ihrer Meinung nach ökologisch und ökonomisch sinnvoll?
MW: Es wird immer eine Fall-zu-Fall-Entscheidung sein, ob ein Stoff durch einen biologisch abbaubaren oder anderen Stoff ersetzt oder eben ganz verboten wird. Bei der Entwicklung unseres Evaluierungsschemas gehen wir interdisziplinär vor, das heißt, wir beziehen unterschiedlichste Blickwinkel mit ein. Es gibt viele Bereiche im Alltag, in denen es keinen Sinn macht, auf Kunststoffe zu verzichten. Würde man zum Beispiel bei einem Auto alle Plastikteile entfernen, würde das den Treibstoffverbrauch wegen des höheren Gewichts immens steigern – und Räder aus Holz wären natürlich Unsinn (lacht).
Bei Mulchfolien, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, um den Wasser- und Pestizidverbrauch zu verringern, kann biologische Abbaubarkeit sehr sinnvoll sein. Folien aus konventionellem Plastik muss man nämlich wieder einsammeln. Dabei kommt es zu Verlusten, und das Recycling gestaltet sich durch die Verschmutzung mit Erde schwierig, sodass es kaum stattfindet. Im Ackerboden lassen sich biologisch abbaubare Folien problemlos unterarbeiten, wenn der Acker umgelegt wird. Natürlich muss der Abbau für die Umwelt unbedenklich sein. Auch in Fällen, in denen ein so genanntes „großes Verlustrisiko“ besteht, etwa bei Fischereiartikeln oder Zigarettenstummeln, bietet sich biologische Abbaubarkeit an. Ein dritter Bereich, in dem dies zweckmäßig ist, sind Artikel wie Autoreifen, Schuhsohlen, Textilien, Farbanstriche und übrigens auch Solarpanele, die sich im Laufe der Zeit abnutzen und durch deren Abrieb Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Ein gewisser Eintrag ist hier nicht zu vermeiden. Gerade hier brauchen wir daher schnelle und unbedenkliche Lösungen, die durch ein umweltrelevantes Evaluierungsschema geprüft worden sind.


Wie sieht es denn mit Plastiktellern und -bechern aus? Die kennen wir ja alle und nutzen sie gerade in der Corona-Zeit noch häufiger.
MW: Natürlich werden wir auch in Zukunft, selbst nach Corona, eine To-go-Gesellschaft bleiben. So realistisch muss man sein. Aber auch hier kommt es auf den Einzelfall an. Eine gute Idee sind zunächst einmal Mehrwegsysteme. Beim Picknick können wir zum Beispiel unser eigenes Geschirr mitbringen. Für Weihnachtsmärkte gibt es bereits das Modell, dass alle Stände die gleichen Teller verwenden, die dann in einer Spülstation gereinigt werden. In einzelnen deutschen Städten wird ein Mehrweg-Pfandsystem für „Coffee to go“ getestet, an dem sich diverse Anbieter beteiligen. Die Verbraucher kaufen sich ein Getränk, beispielsweise im Coffeeshop, und können ihre gebrauchten Becher einfach beim nächsten Anbieter, zum Beispiel einer Bäckerei, abgeben. Dort wird er dann gespült und kommt wieder in den Kreislauf. Bei Großveranstaltungen haben sich wiederum biologisch abbaubare Produkte bewährt, die dann zusammen mit den Essensresten in die Kompostieranlage gehen. Wenn wir als Gesellschaft nachhaltiger werden wollen, kommt es natürlich auch darauf an, was der Konsument bereit ist zu zahlen. Das ist ein komplexes gesellschaftliches Thema, und Bioplastik ist ein Teil davon.
Brauchen wir beim Bioplastik vielleicht einfach einen längeren Atem, wie bei anderen technologischen Entwicklungen auch?
MW: Den brauchen wir auf jeden Fall. Ich als Meeresbiologin, die viel in der Natur unterwegs ist und die Folgen direkt sieht, halte es für unabdingbar, dass wir weiterforschen und Lösungen entwickeln. Zum Glück sind sich Verbraucher, NGOs, Industrie und Regierungsstellen einig, dass Plastik in der Umwelt keine gute Sache ist. Das Problem der Becher und Tüten bekommen wir sicherlich in den Griff, schwierig wird es bei den vielen bereits erläuterten Einträgen in unsere Umwelt, die wir nicht vermeiden können oder wollen. Die passieren jeden Tag, und steigen leider kontinuierlich an.
Dann wäre es also ökologisch vertretbar, weiterhin in die Erforschung alternativer Kunststoffe zu investieren?
MW: Absolut. Allerdings ist die Material- und Produktentwicklung mit hohen Kosten verbunden, da das alternative Material ja exakt die gleichen Anforderungen – beispielsweise Reißfestigkeit oder Feuerfestigkeit – wie das bisherige Material erfüllen muss. Womit wir wieder beim längeren Atem sind. Das sehe ich aber durchaus positiv: Die Politik und Industrie in Europa hat ja das Potenzial, hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Und dann würde es sicherlich schnell interessante neue Materialen zu erschwinglichen Kosten geben – wie gesagt, auch gerade für den nicht-vermeidbaren Eintrag.
Was würden Sie den Verbraucher*innen empfehlen?
MW: Ich kann den Verbraucher*innen nur Mut machen, das Thema Plastik im Alltag immer wieder aufs Tapet zu bringen, sei es in der Familie, unter Freunden oder auf der Arbeit. Dies ist ein wichtiger Hebel, der oft unterschätzt wird. Ohne das Engagement der Verbraucher*innen wäre das neue EU-Verbot für Wegwerfprodukte aus Plastik längst nicht so schnell auf den Weg gebracht worden. Die Unterstützung aus der Öffentlichkeit wäre auch eine große Hilfe für unser Evaluierungs- und Testschema, das wir zurzeit entwickeln. Wenn wir diese Norm haben, können wir sehr viel schneller und unkomplizierter herauszufinden, ob ein Produkt unbedenklich biologisch abbaubar und damit tatsächlich umweltfreundlich ist.
Vielen Dank für dieses Informative Gespräch.