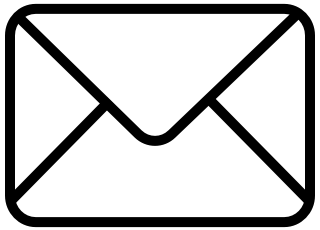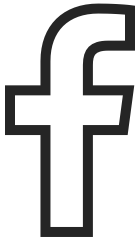Plastik ist das neue Bio

Biokunststoffe bekommen nach wie vor Gegenwind. Doch was ist an den Einwänden dran? Und welche Anwendungen sind wirklich nachhaltig?
Politik, Industrie und Umweltverbände sind sich einig: Plastik schadet der Umwelt und sollte, wenn möglich, vermieden werden. Mitte 2021 tritt daher das EU-Plastikverbot in Kraft, das den Einsatz von Einwegplastikprodukten wie Bestecken, Tellern und Einwegverpackungen verbietet. Parallel dazu arbeitet eine ganze Industrie auf Hochtouren daran, umweltfreundliche Ersatzstoffe für das erdölbasierte Material zu entwickeln. Doch nicht alles, auf dem „Bio“ steht, ist auch tatsächlich Bio. Der Begriff „Bioplastik“ ist nicht geschützt, und manche Stoffe sind umstritten – sowohl, was die Produktion, als auch, was die Entsorgung angeht. Aller Kritik zum Trotz lohnt es sich, genauer hinzuschauen, welche Materialien und Anwendungen ökologisch und ökonomisch vertretbar sind.
Konventionelles Plastik basiert auf Erdöl, das sowohl in der Gewinnung als auch in der Entsorgung fragwürdig ist, da beides nicht nachhaltig ist. Wir alle haben Bilder riesiger Plastikmüllinseln und verendender Meerestiere im Kopf. 2018 machte eine Plastiktüte Schlagzeilen, die am tiefsten Punkt der Ozeane im Marianengraben gefunden wurde. Auch die Belastung mit Mikroplastik ist eine reale Gefahr. Am besten wäre es daher, ganz ohne Plastik auszukommen. Doch das klingt wenig praktikabel. Können und müssen wir wirklich vollständig auf Plastik verzichten?
Bereits seit Jahren entwickelt sich ein breitgefächerter Markt an alternativen Stoffen. Am bekanntesten und häufigsten eingesetzt sind Verpackungen, Einwegbecher oder Tüten aus Bioplastik. Aber auch in anderen Bereichen, etwa in der Automobilindustrie und in der Elektronik, wird intensiv geforscht, um erdölbasierte Kunststoffe durch nachhaltigere Alternativen zu ersetzen. Ein weites Feld. Constance Ißbrücker, Expertin vom Branchenverband European Bioplastics, räumt ein, dass das Thema für sie selbst nach jahrelanger Forschungsarbeit immer noch komplex sei.
Biobasiert, biologisch abbaubar – am besten beides
Die Grunddefinition von „Bioplastik“ ist da vergleichsweise einfach: Als Biokunststoff wird ein Material bezeichnet, wenn es entweder biobasiert, biologisch abbaubar oder beides ist. Letzteres ist ökologisch am sinnvollsten. Biobasierte Kunststoffe werden teilweise oder ganz aus Biomasse, sprich: stärke- und zellulosereichen Pflanzen wie Mais oder Miscanthus, manchmal auch aus Ölsaaten oder Holz hergestellt. Tierische Produkte kommen dabei bislang nur wenig zum Einsatz. Erzeugnisse von Bakterien werden in Form von Polymilchsäure (PLA) und Polyhydroxybuttersäure (PHB) verwendet. Zu den Kunststoffen, die sowohl biobasiert als auch biologisch abbaubar sind, zählen PLA und Polyhydroxyalkanoate (PHA) sowie Polybutylensuccinat (PBS). Entgegen der verbreiteten Meinung gibt es tatsächlich auch biologisch abbaubare Kunststoffe, die auf fossilen Ressourcen basieren, etwa das Polymer Polybutylenadipat-terephthalat (PBAT). Wenn ein Biokunststoff biologisch abbaubar ist, zersetzt er sich und hinterlässt nichts als CO2, Biomasse und Wasser. Der Abbau hängt aber auch von den Umgebungsbedingungen ab. Mit anderen Worten: Wenn sich ein Stoff in der industriellen Kompostieranlage biologisch abbaut, geschieht dies nicht automatisch auch auf Ackerböden, in Seen oder im Meer.
Biokunststoffe bekommen viel Gegenwind
Die weltweite Produktionskapazität für biobasierte und biologisch abbaubare Kunststoffe lag 2019 nach Schätzungen von Branchenexperten bei ca. 1,95 Millionen Tonnen. Dies entspricht knapp einem Prozent der konventionellen Kunststoffproduktion. Das klingt erst einmal wenig. Dennoch wird den Biokunststoffen Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion vorgeworfen, da der Anbau der hierfür verwendeten Pflanzen Ackerflächen verbraucht. Auf der Website des Umweltbundesamtes heißt es, Bioplastik sei nicht weniger umweltschädigend als fossile Kunststoffe, die Auswirkungen würden sich eher verschieben: „Während konventionelle fossilbasierte Kunststoffe mehr klimawirksames CO2 freisetzen, äußert sich der ökologische Fußabdruck biobasierter Kunststoffe in einem höheren Versauerungs- und Eutrophierungspotential (Eutrophierung = Anreicherung mit Nährstoffen, Anm. d. Redaktion) sowie einem gewissen Flächenbedarf.“ Zudem berichten Medien immer wieder darüber, dass sich biobasierte und bioabbaubare Materialien in den meisten Kompostieranlagen nicht vorschriftsmäßig zersetzen würden.
Das Nutzungsszenario muss passen
Was ist an diesen Einwänden dran, und lassen sie sich pauschalisieren? Der Verein Cradle to Cradle rät gegenüber dem Verbraucherportal Chip 365 davon ab, Biokunststoffe generell zu verteufeln. „Ein Kunststoff kann gut sein, wenn er für das Nutzungsszenario passt, biologisch abbaubar ist oder leicht im technischen Kreislauf bleibt, also weiterverwertet werden kann.“ Aktuell gibt es zahlreiche Forschungsansätze, biologisch abbaubare Kunststoffe aus organischen Abfällen herzustellen, die anderweitig kaum nutzbar sind. So unterstützt Hydra Marine Sciences durch seine Forschung eine offizielle Evaluierungsmethode für die biologische Abbaubarkeit unterschiedlichster Plastikarten. Durch Prüfung und Kennzeichnung, unter welchen Umweltbedingungen ein Stoff biologisch abbaubar ist, soll sich künftig schneller erkennen lassen, ob ein Biokunststoff wirklich nachhaltig ist.
Das Institut empfiehlt zwar, Plastik in erster Linie zu reduzieren, sieht es aber als eine Fall-zu-Fall-Entscheidung an, ob ein Stoff durch einen biologisch abbaubaren Stoff ersetzt werden könne. Institutsleiterin Miriam Weber nennt eine Reihe von Beispielen aus der Landwirtschaft, Fischerei sowie Textil- und Automobilindustrie, bei denen biologische Abbaubarkeit durchaus vertretbar sei. Gegenstände wie Teller und Tassen, die ab Juli 2021 EU-weit unter das Verbot von Einwegplastikprodukten fallen, sollten aber nicht einfach durch Pendants aus Bioplastik ersetzt werden, so die Meeresbiologin. Auch das Umweltbundesamt rät in diesem Fall zu wiederverwendbaren Produkten. Sowohl Miriam Weber von Hydra als auch Constance Ißbrücker von European Bioplastics sprechen sich indes für die Nutzung biologisch abbaubarer Lebensmittelverpackungen aus, sofern diese zusammen mit den Essensresten in die Biotonne entsorgt werden können.
Könnte sich bald deutschlandweit durchsetzen: der Bioabfallbeutel
Ein Produkt, das bereits vom Umweltbundesamt abgesegnet wurde, ist der zertifizierte Bioabfallsammelbeutel mit dem Keimlingssymbol. Mit dem biologisch abbaubaren Beutel lassen sich Küchenabfälle besonders hygienisch entsorgen, und er ist auch schon in diversen Haushalten etabliert. So lässt sich der Anteil an verwertbarem Bioabfall, der in den Kreislauf zurückgeführt wird, erheblich steigern, der Restmüll reduziert sich. Denn gerade in Deutschland ist der Anteil ungenutzten Bioabfalls, der in die Restmülltonne wandert, mit 40 Prozent immer noch sehr hoch. Das Beispiel des Bioabfallbeutels zeigt aber auch, wie weit Regularien und Realität manchmal auseinanderklaffen. Ob der Beutel tatsächlich für die Sammlung von Bioabfällen genutzt werden darf, hängt aktuell noch von der jeweiligen Stadt oder dem Landkreis ab. Offiziell braucht er in den meisten Kompostieranlagen nämlich zu lange, um sich abzubauen. In Wirklichkeit schafft das Gros der Biobeutel die Kompostierung aber sehr viel schneller, sprich: innerhalb der Kompostierzeiten der Anlagen. Ein entsprechendes EU-weites Label für Materialien mit kürzeren Kompostierzeiten ist derzeit in Arbeit.
Fazit: Selbst für Wissenschaftler*innen ist Bioplastik ein äußerst komplexes Thema. Nicht minder komplex sind daher die Antworten und Lösungen. Ob ein biobasierter und/oder biologisch abbaubarer Stoff tatsächlich nachhaltig ist, kommt sehr auf die jeweilige Gewinnung, Anwendung und Weiterverwertung an. Bei Wegwerfartikeln wie Bechern und Tellern raten sowohl Umweltbundesamt als auch Branchenexpert*innen zu Mehrwegsystemen. In anderen Fällen, etwa bei bestimmten Lebensmittelverpackungen, in der Automobilindustrie oder auch beim Abfallbeutel für Biomüll können Biokunststoffe durchaus Sinn machen. Wie bei jeder Technologiewende, braucht es für die Umsetzung jedoch einen langen Atem. Viele Materialien sind derzeit noch in Entwicklung, und es wird wohl auch noch einige Zeit dauern, bis die Gesetzgebung die Realität eingeholt hat. Aktuell werden neue Labels und Standards erarbeitet, die die Verbraucher*innen bei ihren Produktentscheidungen unterstützen sollen.